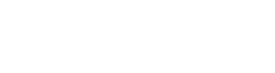Riedertal und Burghölzli: Zum frühen Max Gubler
Die Anfrage des Kunstmuseums Bern, ob ich als Gastkurator für die Ausstellung «Die Farbe und ich. Augusto Giacometti» (19. September 2014 bis 15. Februar 2015) mitarbeiten würde, war weniger überraschend als naheliegend. Denn mit diesem Künstler, der zusammen mit den anderen Giacometti ebenso entscheidend zum «Phänomen Stampa» beigetragen hat und der wegen eines eindrücklich umfangreichen Sammlungsbestandes zu den «Säulenheiligen» des Bündner Kunstmuseums gehört, habe ich mich wissenschaftlich mit Aufsätzen und einer Buchpublikation ebenso intensiv beschäftigt wie vermittelnd mit mehreren Ausstellungen. Die enge Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Bern war eine wunderbare Erfahrung, auch wenn die Aufgabe komplex und herausfordernd war.
Die Anfrage von Matthias Frehner, ob ich denn auch als Gastkurator für die Ausstellung «Max Gubler. Ein Lebenswerk» mitwirken würde, war hingegen deshalb überraschend, weil ich mich im Unterschied zu Augusto Giacometti zuvor mit Gubler noch nicht explizit beschäftigt hatte, wenngleich mir sein Werk und sein Lebensschicksal, in erster Linie aber die höchst wechselvolle Rezeption, keineswegs unvertraut waren. Ich sagte schliesslich zu, und zwar auf Grund einer Motivation, von der man in Bern nicht wissen konnte. Als ich in den 1950er-Jahren im Kanton Uri aufwuchs, gehörte es zur (katholischen) Pflicht, einmal im Jahr die Wallfahrt zur Kapelle im Riedertal zu absolvieren – keine schöne Erinnerung, denn uns Schülern kam der mühselige Gang in dieses schattige Tal endlos vor. Im letzten Herbst nahm ich – wegen Gubler – diesen Weg nach Jahrzehnten wieder unter die Füsse: Ein lockerer, knapp halbstündiger Spaziergang in ein wunderliches, abseitiges Tal voll von religiösem Volksglauben und heidnischen Mythen.

Max Gubler, Winterlandschaft Burghölzli um 1919, Öl auf Leinwand 83 x 102 cm Kunstmuseum Bern. © Eduard, Ernst und Max Gubler-Stiftung, Zürich
Im Sigristenhaus neben der Wallfahrtskapelle hielt sich die ganze Familie Gubler aus Zürich seit 1908 während vieler Jahre immer wieder auf. Nicht im Süden, wie die meisten damaligen Künstler, sondern im schroffen Riedertal haben die drei Brüder Eduard, Ernst und Max Gubler ihre Gegenwelt gefunden und die Ursprünglichkeit des abgeschiedenen, magischen Tales voller Mythen mit den einfachen Bauersleuten in zahlreichen Bildern und Skulpturen künstlerisch gedeutet. Die Brüder Gubler stiessen dabei in der Pfarrkirche von Bürglen auf eine Tafel von Hans Fries (1502) mit der Darstellung von Christus unter der Last des Kreuzes: Ein Glücksfall, dass sich eine von Fries‘ Varianten des Themas in der Sammlung des Kunstmuseums Bern befindet und deshalb in die Ausstellung integriert werden konnte. So wird augenfällig, wie alle drei Gubler Brüder das Passionsthema profanierten und das Geschehen im lokalen Umfeld ansiedelten – und vor allem wird manifest, welche wichtige Rolle die Spätgotik als Anregung für den frühen Schweizer Expressionismus und die Neue Sachlichkeit spielte.
Wenn im Zentrum der Ausstellung «Max Gubler. Ein Lebenswerk» sein Schaffen der 1940er- und 1950er-Jahre im Zentrum steht, mit dem der Künstler zum gefeierten Ausnahmetalent der Schweizer Malerei avancierte, und wenn die letzten, während Jahrzehnten unter Verschluss gehaltenen Werke besondere Aufmerksamkeit erheischen, so ist der Auftakt zur aussergewöhnlichen Karriere Max Gublers ebenso fundamental. Deshalb ist den frühen Werken Gublers im engen Dialog mit den Arbeiten seiner Brüder Eduard und Ernst in der Ausstellung ein eigener Raum gewidmet. Er zeigt eindrücklich, wie sich Gubler als ganz junger Künstler die modernen, virulenten Tendenzen zu eigen machte und wie er den existenziellen Nöten und Ängsten und den beklemmenden Erfahrungen der Zeit expressiven Ausdruck verlieh. Bei den beiden stadtnahen Landschaftsdarstellungen von Riesbach in Zürich steht der Gebäudekomplex des Burghölzli, der psychiatrischen Klinik, im Zentrum. Die Wahl für das kuriose Motiv gründet auf Gublers damaliger Vorliebe für randständige Existenzen. Sie zeigen Gublers Wandel vom Expressionismus hin zur Neuen Sachlichkeit in geradezu exemplarischer Weise. Gublers Interesse für diesen Ort der Verrücktheit kann als Ironie des Schicksals bezeichnet werden: Jahrzehnte später wurde er 1969 ins Burghölzli eingewiesen, wo er bis zu seinem Tod 1973 lebte.
Veröffentlicht unter Experten am Werk
Schlagwörter: Gemälde, Max Gubler