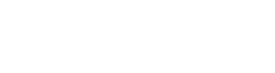Ein Gespräch mit Xerxes Ach
Für die Vorbereitung der Ausstellung «Silvia Gertsch, Xerxes Ach: Sinnesreize» hat sich die Kuratorin Kathleen Bühler mit dem Künstler Xerxes Ach zum Gespräch in seinem Atelier in Rüschegg getroffen.

Xerxes Ach bei der Arbeit in seinem Atelier in Rüschegg. © Silvia Gertsch, Xerxes Ach, Rüschegg
Xerxes Ach: In jungen Jahren habe ich mit allem Möglichen experimentiert, man probiert Verschiedenes aus. Dann ging es mehr in die monochrome Richtung und ich begann, mit Ölfarbe auf Papier und Kreidegrund zu malen.
Kathleen Bühler: Welchen Effekt erzielt man damit?
Schöne matte Farben. Man mischt in einer Glasschüssel einen Brei mit Hasenleim, Champagnerkreide und Titanweiss an, der fein verteilt wird. Das ergibt eine schöne Fläche und wirkt wie ein blinder Spiegel. Als ich Silvia Gertsch kennenlernte, machte ich nur noch Kreidegründe in der Absicht, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu bemalen. Sie stehen heute noch in meinem Lager. Die Technik wurde mir mit der Zeit zu aufwendig. Für die Stipendienausstellung in Zürich (Werk- und Atelierstipendien der Stadt Zürich, Helmhaus, 1991) habe ich sie monochrom bemalt und gewann damit das Atelier in Genua (1992). Dort begann ich mich nach einer schnelleren Technik zu sehnen, weil es mir zu langsam vorwärts ging. So begann ich mit Lack auf Packpapier zu arbeiten. Dieses spannte ich in mehreren dicken Lagen auf einen Keilrahmen und trug den pigmentierten Lack in mehreren Schichten aufs Papier.

Farbpigmente bevor sie vermischt werden. © Silvia Gertsch, Xerxes Ach, Rüschegg
Wie viele Schichten Lack waren das?
Es waren zwischen fünf und zehn Schichten Glanzlack. Mendes Bürgi organisierte dann die Ausstellung Von Nah (1995) in der Kunsthalle Zürich, in der ich eine ganze Wand mit 15 Arbeiten bespielte. In den Neunzigerjahren hatte ich auch eine Phase, in der ich mit Öl und Wachs auf A4-Papiere zuvor gesammelte Farben malte und auf diese Weise Farben sammelte (Teile 1-33). Es ist eigentlich ein offenes System. Harm Lux hatte sie für die Ausstellung (Salon, Shedhalle Zürich, 1990) in einer Abfolge angeordnet, in der sie bis heute geblieben sind. Er hatte ein gutes Gefühl für Farben. Das war für mich der Anfang meines „gültigen“ Werkes. Eine malerische Komposition, jedoch nicht innerhalb des Bildes, sondern mittels der Einzelteile.
Wie kam es zum Bruch zwischen den Arbeiten aus den Achtzigerjahren und den monochromen Werken des nächsten Jahrzehnts?
Ich war in den Achtzigerjahren in Berlin. Salomé, Fetting und Middendorf waren die Helden. Ich malte ebenfalls sehr expressiv. Doch war das für mich nicht so „gültig“. Es war eher Mitläufertum. Später in Zürich kam ich in Berührung mit anderer Kunst. Anfangs waren es konstruktiv-konkrete Maler, die mich inspirierten, obwohl meine Arbeiten sinnlicher sind. Dann sah ich in Ausstellungen monochrome Aluminiumplatten von Adrian Schiess oder monochrome Werke von Thomas Stalder (Ausstellungsraum Bildraum, Zürich). Ganz wichtig war jedoch Blinky Palermo, dem Mendes Bürgi eine Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur ausrichtete. Was ich da sah, inspirierte mich mehr als die Zürcher Konkreten.
Vom Komponieren mit mehreren Bildern ging es dann sehr schnell in den Raum. War das geplant?
Das war ein Zufall. Für meine Eingabe beim Eidgenössischen Stipendium bereitete ich grossformatige Lackarbeiten (Teile, 1995) vor, die ausgezeichnet und dann im Kunsthaus Glarus (1995) ausgestellt wurden. Diese vier grossformatigen Tafeln wollte ich eigentlich an die Wand hängen. Eins hing schon und die drei anderen standen noch schräg an der Wand. Dabei wurde uns schlagartig klar, dass die schräg gestellten viel mehr Licht reflektierten, und wir liessen sie deshalb angelehnt an die Wand stehen. Man spiegelt sich noch besser in ihnen, wenn sie auf dem Boden stehen, und kann in sie eintauchen. Das Bild wurde so zum Objekt.
Für dich ist ein Bild kein Fenster zur Welt, sondern primär ein Objekt?
Die stoffliche Materialität war mir immer wichtig. Nach meiner Packpapierphase kam dann die Zeit, in der ich direkt mit Lack auf Aluminium zu arbeiten begann. Auch Packpapier wurde mir zu fragil.
Weshalb hast du deine Farben selbst angemischt?
Lacke und industriell hergestellte Farben enthalten so viele Lösungsmittel, dass mit der Zeit meine Gesundheit davon angegriffen wurde. Da ich grosse Mengen von Lack verarbeitete, wurde es zu viel. Dazu kam noch der Umstand, dass ich nicht lüften konnte, weil es dann möglicherweise Staubfasern auf die spiegelglatte Malfläche geweht hätte. Ich habe den Geruch selbst gar nicht mehr wahrgenommen, doch Besucher waren von den Dämpfen in meinem Atelier gestresst. Auch bei der Arbeit mit Ölfarbe, zu der ich Unmengen an Terpentin brauchte, war es nicht besser. Beim Auftragen von Polyurethan-Lack auf Aluminium war das Problem, dass das Aluminium völlig fettfrei sein muss, damit der Lack hält. Die Platte musste also immer mit Aceton entfettet werden – ohne Schutzmaske damals, versteht sich. Wenn man jung ist, achtet man nicht auf seine Gesundheit und handelt leichtsinnig. Ich litt oft unter Husten, und mir wurde klar, dass diese Materialien für mich keine Zukunft hatten. Beim Recherchieren nach Alternativen stiess ich auf althergebrachte Methoden wie Eitempera. Zwar ist es ziemlich anspruchsvoll und aufwendig, Eitempera-Farbe anzumischen, doch weil mir die Materialität der Farbe wichtig war, lohnte es sich schon allein deshalb. Nach vielem Ausprobieren entwickelte ich um 1990 nach der Ausstellung in der Kunsthalle Winterthur mein eigenes Rezept. Das Ei ist der Emulgator, und dadurch kann man ohne Lösungsmittel Öl und Pigmente vermischen. Doch braucht es viele Eidotter pro Bild. Wenn das Bild frisch gemalt ist, riecht man es sogar noch. Anfangs malte ich damit die Paintings, die einen feinen Rahmen beziehungsweise Untermalungen am Bildrand zeigen. Im Prinzip sind alle Gemälde in Komplementärkontrasten untermalt. Doch sieht man es bei den früheren Lackarbeiten nur in seitlicher Sicht. Mit der Zeit liess ich die unteren Schichten an den Rändern sichtbar werden. Daraus entstanden dann die späteren dreifarbigen Paintings mit den breiten Rahmen.

Die Eitempera wird vorbereitet. © Silvia Gertsch, Xerxes Ach, Rüschegg
Sie erinnern mich stark an abstrakte Ikonen, weil sie mit ihrem innerbildlichen Streifen etwas Strahlendes einrahmen.
Dieser Effekt ist erwünscht, denn es geht mir um Transzendenz. Sie stellt sich ein, wenn unzählige transparente Farbschichten ihre magische Wirkung entfachen. Oft beginne ich mit sehr starken Farben und übermale sie immer wieder. Am Schluss kommt jeweils die hellste Farbe. Manchmal verzweifle ich fast, wenn ich einen Farbton nicht treffe. Wenn man die Farbe selber herstellt, hat jede Farbe andere Eigenschaften. Jedes Pigment verhält sich anders. Das unterscheidet sie von der industriell hergestellten.
Wie legst du die Farbkombinationen fest? Skizzierst du vorher oder malst du spontan drauflos?
Ich lege sie konzeptuell fest. Als Ausgangspunkt nehme ich Farbabbildungen in Büchern, Zeitschriften, Zeitungen oder eigene schriftliche Aufzeichnungen, in denen ich starke Farberlebnisse notiert habe. Diese definieren den Spielraum der gestalterischen Entscheidungen. Mir geht es um die Farbkomposition. Von wo die Inspiration herkommt, spielt keine Rolle. Das können Modebilder, Reiseaufnahmen, textile Muster oder Sportillustrationen sein. Es gibt keine Hierarchie, sondern es reicht vom Trivialsten bis zum Kunstbuch. Ich bin ein Augenmensch und nehme mir die Inspirationen, wo ich sie finde. Man nimmt etwas, was eine Reaktion auslöst und ein interessantes Bild ergeben könnte. Doch male ich letztlich Teile meiner Seele, meine Sehnsuchtsbilder, meine Visionen und denke dabei nicht an einen anderen Betrachter. Deshalb ist der Ausgangspunkt – die Vorlage, die mich farblich reizt – völlig nebensächlich. Es sind meine Bilder, sie kommen aus meinem Inneren und sie sind ein Stück von mir. Ich male die Bilder, die ich selber gerne sehen möchte.
Wie erreichst du immer wieder dieses Gleichgewicht, das sich in deinen Kompositionen einstellt und nicht einen Stillstand bezeichnet, sondern eine Balance der Kräfte?
Das hat mit den komplementären Farbbeziehungen zu tun sowie mit dem Umstand, dass das Licht und die Farbe aus dem Dunkeln kommen. Auf diese Weise beginnen sie – etwa in Cosmic Light (2013) – zu schweben. Wenn man hell in hell malt, ergibt es einen ganz anderen Effekt. Doch die hellste Farbe als Schlussschicht ist das reine Licht, das aus dem Dunkeln leuchtet und im Raum schwebt. Es handelt sich sozusagen um materialisiertes farbiges Licht. Am schwierigsten sind dabei die Übergänge, die ganz dünn als Lasuren gemalt sind. Mein ganzes Œuvre ist in ständiger Transformation, durch die sich rote Fäden ziehen. Was gleich bleibt sind die zahlreichen Schichten, die erlauben, in meine Bilder einzutauchen. Der Betrachter kann in einen Farbraum eintreten. Aus diesem Grund haben gewisse Titel räumliche Assoziationen: Colorscapes (1996-1999) zum Beispiel – eine farbige Landschaft wie in einem Traum oder einem Film. Sie sind so gemalt, dass sie im Untergrund komplementär aufgebaut sind und gegen oben immer weniger Pigment, dafür mehr Lack haben. Auf diese Weise sind sie opak und wirken unergründlich tief. Sie hängen vor der Wand und scheinen zu schweben.

Xerxes Ach, Cosmic Light, 2013 Eitempera auf Baumwolle, 150 x 150 cm.
Spannend ist auch der Wechsel von der lackierten, glänzenden Oberfläche zur matten, samtenen Farbhaut.
Das kam durch die Umkehrung meiner Arbeitsweise. Waren es in den Colorscapes die obersten Schichten mit wenig Pigment und viel Lack, haben in den Cosmic Light oder Paintings die obersten Schichten viel Pigment und wenig Bindemittel. Es geht mir um die Erscheinung der Malerei, ihre Sinnlichkeit: entweder lackiert, geschlossen und kühl oder durchlässig, wolkig und samten. Nach dem Ikonenhaften kam mit Cosmic Light und aktuellsten Werken wieder Bewegung ins Bild. Nachdem ich eine Weile lang auch aquarelliert hatte, wollte ich Bilder malen, welche diese Leichtigkeit spüren lassen, gleichzeitig aber dem Zufall Raum geben. Dabei kam ich endlich weg vom quadratischen Format. Es war eine grosse Befreiung vom früheren Konzept.
Am Dienstag 24.11.2015 um 19h führt Etienne Wismer zusammen mit dem Künstler Xerxes Ach durch die Ausstellung «Silvia Gertsch, Xerxes Ach: Sinnesreize».
Veröffentlicht unter Allgemein, Experten am Werk
Schlagwörter: Malerei, Sinnesreize, Xerxes Ach