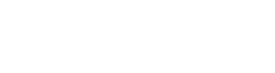Ein anderer Zugang zur chinesischen Realität – Interview mit Uli Sigg
Der ehemalige Schweizer Botschafter, Unternehmer, Mäzen und Sammler Uli Sigg besitzt die weltweit grösste und bedeutendste Sammlung chinesischer Gegenwartskunst. Im Interview mit Maria-Teresa Cano erzählt er, wie er sich der chinesischen Kultur näherte, diese einzigartige Sammlung zusammengetragen hat und warum es ihm so wichtig ist, sie nach einer letzten Ausstellung im Westen, wieder in ihre Heimat China zu schicken.
Sie haben die weltweit grösste Sammlung zeitgenössischer chinesischer Kunst. Wie kommt ein Schweizer Manager und Diplomat dazu, sich so lange und so intensiv mit der Kunst einer Kultur auseinanderzusetzten, die uns im Westen noch immer fremd und unnahbar erscheint?
Aus zwei Gründen: Ich war schon immer an Gegenwartskunst interessiert, deshalb war es für mich ganz natürlich, mich in meiner neuen Umgebung, also in China, danach umzuschauen, was die Gegenwartskünstlerinnen und -künstler tun. Der zweite Grund war: Ich kannte die chinesische Kultur nicht. Ich bin ganz unvermittelt in dieses Projekt der Firma Schindler hineingekommen und ich wollte mir einen anderen Zugang schaffen, als denjenigen, den mir das offizielle China erlaubte: Ich war ja nie unbeobachtet und wurde ständig begleitet.

Uli Sigg neben dem Gemälde «Moon Rabbit» von Shao Fan. © Sigg Collection. Photo: Karl-Heinz Hug
Mussten Sie in einem Prozess der Annäherung gewisse Hemmnisse und Verständnisbarrieren abbauen?
Ganz klar! Vor allem in den ersten Jahren, in denen die Gegenwartskunst völlig anders aussah als das, was wir hier im Westen darunter verstehen. Die chinesischen Künstlerinnen und Künstler hatten eben erst begonnen, chinesische Gegenwartskunst zu machen. Vorher war alles Auftragskunst, Propagandakunst, und ganz unvermittelt konnten sie plötzlich eigene Vorstellungen auf die Leinwand bringen. Das war ein Bruch mit der Vergangenheit. Mit diesem Kontext musste ich mich zunächst vertraut machen.
Wie haben sich die Begegnungen mit den Künstlerinnen und Künstlern ergeben?
Die ersten Begegnungen kamen durch gemeinsame Freunde zustande. Dann kam eins zum anderen: Die Künstler haben mich zu anderen Künstlern mitgenommen und irgendwann wollten sie mich kennenlernen – den Exoten, der Geld für chinesische Gegenwartskunst ausgibt und der Gespräche mit ihnen führt. Sie waren es absolut nicht gewohnt, mit jemandem über ihre Kunst zu sprechen, der vielleicht auch Rat wusste, was man ausserhalb von China mit dieser Kunst anfangen könnte. Ausserdem habe ich einen Kunstpreis geschaffen, durch welchen ich bei Künstlern rasch einen höheren Bekanntheitsgrad erreichte.
Was denken Sie, ist Ihre wichtigste Triebkraft für das Sammeln? Ist es Ihre Aufmerksamkeit und die Neugier, die ein Bild oder eine Plastik in Ihnen auslöst, oder die Begegnung mit den Künstlerinnen und Künstlern?
Mein ultimatives Studienobjekt war eigentlich China und ich wollte mich über die Kunst und die Begegnung mit den Künstlern über China informieren. Ich hätte mein Ziel nicht erreichen können, wenn ich in eine Galerie gegangen wäre und mir ein Produkt gekauft hätte. Erst später habe ich realisiert, dass niemand diese Kunst systematisch sammelt und habe mich auf das explizite Sammeln besonnen. Dabei ging es mir nicht so sehr darum, diese Kunstwerke zu besitzen, sondern ich hatte immer die Absicht, diese Werke irgendwann wegzugeben.
Wo sehen sie die grössten Unterschiede zwischen dem chinesischen Kunstmarkt und dem Betrieb hier bei uns?
Das Betriebssystem Kunst, wie wir es im Westen kennen, setzt sich ja aus den Künstlern, Sammlern, Aktionshäusern, Institutionen wie Museen, der Kunstkritik, dem Markt und Galerien zusammen – in China gab es zu Beginn der Gegenwartskunst, also Ende der 70er Jahre, ausser den Künstlerinnen und Künstlern von all dem eigentlich nichts. Das hat sich sehr entwickelt, inzwischen gibt es einen florierenden Kunstmarkt, es gibt Auktionshäuser und hunderte von Galerien. Und die Künstlerinnen und Künstler kennen mittlerweile die Welt, sie reisen, sie sind im Internet. Was jedoch gegenüber unserem System sehr eingeschränkt ist, sind die Tätigkeiten der Institutionen und der Kunstkritik, die weiterhin nur innerhalb bestimmter Schranken möglich sind.

Rita und Uli Sigg auf Schloss Mauensee. Foto: Monika Flückiger
Ich möchte einen Sprung in die Gegenwart machen. Jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem Sie einen grossen Teil der Sammlung nach Hongkong geben. Warum gerade jetzt?
Gut, das hat auch mit meinem biologischen Alter zu tun (lacht). Irgendwann muss man ja für eine Sammlung, die auch eine gewisse Relevanz für China hat und für die ich eine bestimmte Verantwortung trage, eine Lösung treffen. Ausserdem gab es um das Jahr 2010, als ich ernsthaft die Zukunft der Sammlung zu sichern begann, einige sehr grosse Projekte in Shanghai, Peking und Hongkong, auch deshalb erschien mir der Zeitpunkt geeignet. Diese grossen Museumsbauten wurden teilweise realisiert und das war auch ein Grund, sich zu diesem Zeitpunkt zu entschieden.
Und haben Sie nie daran gedacht, Ihre Sammlung in einem Schweizer Museum unterzubringen, vielleicht sogar in einem eigenen Museum?
Nun ja, meine Mittel sind endlich, da fängt es schon an. Ich bin mir im Klaren, was es heisst, ein Museum zu bauen und ein Museum zu betreiben. Ausserdem denke ich, chinesische Gegenwartskunst muss den Chinesen gehören, damit sie ihre eigene Gegenwartskunst überhaupt zu Gesicht bekommen. Es gehört in ihren kulturellen Raum. Die Schweizer Museen haben noch andere Aufgaben, sie könnten sich nicht ganz der chinesischen Gegenwartskunst zuwenden, es würde nicht allzu viel Sinn machen. Hingegen in China, wo jetzt in Hongkong ein grossartiges Museum – jedoch damals noch ohne Sammlung – entsteht, ist die Voraussetzung die allerbeste.
Und wenn der Grossteil Ihrer Sammlung dereinst in Hongkong hängen wird: Werden Sie Ihre Sammelleidenschaft anderweitig ausleben, sich vielleicht einer neuen Kultur zuwenden?
Mein Herz schlägt immer noch für die chinesische Gegenwartskunst, aber ich muss es nicht mehr in derselben Weise betreiben. Es gibt ja sehr viele Sammler, inzwischen haben auch Institutionen damit begonnen. Also meine selbst auferlegte Mission besteht in dem Sinne nicht mehr. Jetzt folge ich Künstlerinnen und Künstlern, die mich besonders interessieren, sammle andere asiatische Gegenwartskunst oder auch mal etwas aus Europa. Das Sammeln ist also in dieser Weise erweitert und anders fokussiert.
Es verbindet Sie eine enge Freundschaft mit Ai Weiwei. Worauf beruht dieses gegenseitige Verständnis?
Es ist sicher eine Frage gegenseitiger Affinität. Was uns verbindet, sind gemeinsame Interessen: eine tiefe Kenntnis der chinesischen Gegenwartskunst, der chinesischen Tradition und der westlichen Gegenwartskunst, diese Kombination ist ganz selten. Da entsteht schon sehr viel gemeinsamer Gesprächsstoff. Ausserdem haben mich seine politischen Analysen sehr interessiert und wir haben stets seine Projekte vertieft besprochen. Manchmal ist im Gespräch etwas entstanden, was er dann realisiert hat.

Ai Weiwei, Fragments, 2005, Eisenholz (Tielimu), Tisch, Stühle, Teile von Balken und Pfeilern von rückgebauten Tempelanlagen der Qing Dynastie (1644–1911) / Ironwood (tieli wood), table, chairs, parts of beams and pillars from dismantled temples of the Qing Dynasty(1644–1911), 500 x 850 x 700 cm. © the artist. M+ Sigg Collection, Hong Kong. By donation
Der «amerikanische Traum» ist uns geläufig, den kennen wir, und wenn man aufmerksam zuhört, erfährt man, dass es jetzt auch den «chinesischen Traum» gibt. Die Regierung propagiert das immer wieder. Was bedeutet der «chinesische Traum» für chinesische Künstlerinnen und Künstler?
Der chinesische Traum ist ein Slogan, er wurde vom Präsident Xi Jingping geprägt. Er hat ihn eigentlich als einen Traum der Nation formuliert. Es ist schwer zu eruieren, was das für das chinesische Individuum bedeutet. Der «chinesische Traum» hält für den Einzelnen nichts Konkretes bereit, ausser mehr Wohlstand. Dies wird auch von chinesischen Künstlerinnen und Künstlern und Intellektuellen thematisiert. Es besteht jedoch das Bedürfnis nach einem «chinesischen Traum». Es besteht ein Bedürfnis, das Wertevakuum, das nach der Zerschlagung aller Ideologien entstanden ist, zu füllen. Das könnte der «chinesische Traum» durchaus leisten, aber dann muss man ihm zweifelslos mehr Inhalt geben.
Im KMB und ZPK öffnet die Ausstellung «Chinese Whispers» für vier Monate ihre Tore. Wir freuen uns sehr auf diesen breiten Querschnitt durch das zeitgenössische chinesische Kunstschaffen. Gibt es einen besonderen Schwerpunkt, der in dieser Ausstellung verfolgt wird, einen Aspekt ihrer Sammlung, den Sie speziell hervorheben möchten?
Also eines ist ja schon bedeutsam: Es sind ausnahmslos neue Arbeiten, die in den letzten zehn Jahren – seit der «Mahjong» Ausstellung – hinzugekommen sind. Ein wichtiges Thema ist die Auseinandersetzung der chinesischen Künstlerinnen und Künstler mit dem globalen Mainstream der Gegenwartskunst. Das ist ein Generalthema in der chinesischen Kultur, sogar in der chinesischen Wirtschaft, in all den Innovationsbestrebungen ist der globale Mainstream Thema. Es ist ein Teil der Ausstellung, diesen Konflikt aufzuzeigen, in dem sich ein chinesischer Künstler immer befindet: Soll er sich von dem Mainstream verschlucken lassen und ein guter Künstler im globalen Wettbewerb sein oder soll er seine Herkunft und seine Kultur in seiner Artikulation nach vorne tragen?
Hat die Ausstellung eine Botschaft an das hiesige Publikum? Oder anders gefragt: Was können wir von der chinesischen Gegenwartskunst lernen?
Die Ausstellung gibt uns über die chinesische Gegenwart, Kultur, Politik und Wirtschaft Aufschluss. China zeichnen ganz unterschiedliche Denkweisen, Ideologien, Realitäten aus, die es zugleich so schwer machen, China zu lesen. In China gibt es alles und das Gegenteil von allem. Die Gegenwartskunst ist in der Lage, diese Spannungen, Ungleichzeitigkeiten und Widersprüche zu verbildlichen und zu verdinglichen – ein Text kann das nicht leisten, man kann Tausende von Seiten darüber schreiben, aber das muss man sehen!
Die Ausstellung «Chinese Whispers. Neue Kunst aus den Sigg und M+ Sigg Collections» eröffnet am Donnerstag, 18.02.2016 im Kunstmuseum Bern und im Zentrum Paul Klee.
Veröffentlicht unter Allgemein, Experten am Werk
Schlagwörter: China, Chinese Whispers, Uli Sigg, Zeitgenössische Kunst