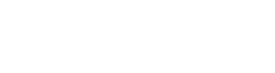Die digitale und die analoge Welt sind kein Widerspruch
Die Digitalisierung ist auch aus dem Museumsalltag nicht mehr wegzudenken. Sie reicht von der digitalen Erfassung von Sammlungsobjekten über die Kommunikation und Vermittlung bis hin zur innovativen Datenerhebung für die Konservierung von Kunstwerken. Im Gespräch äussert sich Nina Zimmer, Direktorin von Kunstmuseum Bern und Zentrum Paul Klee, zu den Herausforderungen und Chancen, die damit verbunden sind.

Nina Zimmer, inwiefern ist die Digitalisierung im Bereich Museum und insbesondere im Kunstmuseum Bern ein Thema?
In der Tat ist die Digitalisierung in den Museen lange unterschätzt worden, dabei ist sie mittlerweile für fast alle unsere Tätigkeiten relevant. Es gibt kaum einen Aspekt der Museumsarbeit, der nicht vom fundamentalen Umbruch, der durch die digitale Revolution eingeleitet wurde, in irgendeiner Weise betroffen ist. Das geht los bei den ganz normalen Dingen, etwa wie wir Informationen beschaffen über Künstler*innen und Kunstwerke, wie wir recherchieren, und wie Informationen verfügbar sind. Während wir noch vor wenigen Jahren als erstes in die Bibliothek gegangen sind und gedruckte Quellen gesucht haben, sind heute schriftliche Dokumente fast schon «verlorene» Daten, weil sie nicht digital suchbar sind. Umso hilfreicher ist es, wenn Archive ihre Daten online stellen, wie das in den USA beispielsweise mit den Protokollen der Entnazifizierungsprozesse geschehen ist, was uns aktuell bei der Erforschung des Kunstfunds Gurlitt zugute kommt.
Wie steht es mit der Digitalisierung der eigenen Bestände?
Wir befinden uns in einer Phase des Umbruchs und es braucht einen enormen Aufwand, um sämtliche Bereiche des Museums von der analogen in die digitale Welt zu überführen – das ist ein Kraftakt. Insgesamt sprechen wir von mehreren tausend Gemälden und Skulpturen sowie mehreren zehntausend Arbeiten auf Papier in der Graphischen Sammlung, die zum Teil noch gar nicht erfasst sind in Datenbanken. Unser Ziel muss es sein, diese Bestände, ausgestattet mit interessanten Schlüsselinformationen, eines Tages fürs Publikum digital zugänglich zu machen.
Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Nicht in die digitale Unsichtbarkeit zu rutschen, ist für uns überlebenswichtig. Wir haben deshalb soeben ein «Sammlung online»-Projekt gestartet, bei dem wir mit Drittmitteln die Werke der Sammlungsdatenbank vorbereiten für eine digitale Publikation. Das sind sehr grosse Datenmengen für eine Migration, hinzukommt, dass die Standards der Datenerfassung nicht überall gleich ist.
Es gibt zahlreiche Museen, die bereits heute Fotos ihrer Werke zur freien Nutzung im Internet zur Verfügung stellen. Wie stehen Sie zu solchen Strategien?
Das Rijksmuseum in Amsterdam ist da z.B. federführend, es hat seit der Wiedereröffnung komplett auf alle Bildrechte verzichtet, man kann auf die Bilddaten aller Werke zugreifen und zum Beispiel auch Regenschirme bedrucken mit Rembrandt-Motiven. Die Absicht des Museums dabei ist, hierarchiefrei die Auseinandersetzung mit seinen Bildmotiven zu ermöglichen, egal ob die Nutzung wissenschaftlich oder kommerziell ist. Das ist natürlich nur möglich bei einer älteren Sammlung, wenn Künstler*innen keine Bildrechte mehr haben. Deshalb macht eine solche Strategie auch nicht für jede Sammlung gleich viel Sinn.
Welches ist für Sie bei der Digitalisierung der Sammlung die grösste Herausforderung?
Die grösste Herausforderung ist für mich der enorme Bedarf an finanziellen Mitteln, um diesen ganzen Systemwechsel zu vollziehen. Wenn man von Pferden auf Autos umsteigt, muss man sämtliche Pferde aufgeben und überall Autos fabrizieren, eine Infrastruktur für Tankstellen bieten, Strassen bauen, auf einmal braucht es auf einen Schlag sehr viel… auch muss man eine ganze Weile beide Systeme aufrechterhalten, was teuer ist. Und wir befinden uns im Kulturbereich, wo Investitionsmittel immer Fördergelder für Kultur sind – und uns dort dann allenfalls fehlen. Gefragt ist aber auch Knowhow, um beide Seiten – Informatik und Kunstwissenschaft – auf sinnvolle Weise zu koppeln.

Gibt es Bereiche innerhalb des Museums, in denen das digitale Umsatteln bereits gelungen ist?
Ja, durchaus, es gibt etwa Pilotprojekte wie die Digitalisierung der Werke von Meret Oppenheim, welche von Helvetia Versicherungen grosszügig unterstützt wird und an dem unsere Abteilung Konservierung und Restaurierung derzeit arbeitet. Hier geht es um Daten in einer ganz neuen Qualität, um 3-D-Daten, die uns ein ganz anderes Wissen über die in ihrer Materialität sehr komplexen Werke der Künstlerin geben. Auch werden sich daraus ganz neue Anwendungen ergeben. Vorstellbar wäre beispielsweise, dass man auf der Basis dieser Daten 3-D-Prints macht, die es sehbehinderten Menschen ermöglichen, die Werke zu ertasten.
Es gibt auch den Trend zurück zum Analogen, wofür das Museum eigentlich der ideale Ort ist.
Tatsache ist, dass die Digitalisierung nicht irgendein Projekt neben vielen, sondern der zentrale Paradigmenwechsel in unserer heutigen Gesellschaft ist. Diesen zu vollziehen und in Einklang zu bringen mit dem System Museum, das ja per se für das analoge Aufbewahren von Wissen und Originalen zuständig ist, ist unsere Aufgabe. Die digitale und die analoge Welt sind kein Widerspruch, im Gegenteil: Dank digitaler Kommunikationsmittel und Social-Media-Kanälen können wir Informationen über unsere Veranstaltungen ganz anders und zeitnah aufbereiten – sei es mit einem Video über den Aufbau einer kurz bevorstehenden Ausstellung oder dem elektronischen Ticketing. Aber natürlich ist unser Kerngeschäft immer noch, Besucherinnen und Besucher für die Erlebnisse im Museum selbst zu begeistern.
Was ist dabei der Mehrwert?
Das Tolle am Museum ist ja – und das müssen wir auch unbedingt verteidigen –, dass es den Raum der authentischen Begegnung mit dem Original ermöglicht. Die digitalen Nutzungen können den Museumsbesuch vor- und nachbereiten und als hybride Ebene zusätzliche Layers zur Verfügung stellen. Die Möglichkeit jedoch, die Qualitäten eines Kunstwerks wirklich zu erleben, bedingt die 1:1-Begegnung im Museum. Denn egal, wie gut ein Scan ist, ein Original hat effektiv immer noch tausende Datenpunkte mehr, verändert sich im Licht und ist dreidimensional. Hinzu kommt das räumliche Erlebnis, man ist in einem Gebäude, in Bern, zusammen mit anderen Menschen. Meine Philosophie ist: Das eine schliesst das andere nicht aus, sondern das eine kann helfen, das andere noch besser zu machen.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Kunst selbst?
Effektiv sind ja inzwischen viele Kunstwerke mittels der neuen Technologien oder durch Erfahrungen, die man mit diesen Technologien hat, entstanden. Die Installationen und Performances der Schweizer Künstlerin Sophie Jung beispielsweise kann man ohne den Erlebnishintergrund ihres Instagram-Profils gar nicht mehr richtig einschätzen. Oder Simon Denny, ein sehr relevanter neuseeländischer Künstler, der sich mit Blockchain-Technologie befasst hat. Da unsere Gegenwart zum Teil nur noch medial vermittelt stattfindet, ist es auch kein Wunder, wenn die Gegenwartskunst sich entsprechend entwickelt oder den Reflektionsraum dafür bietet. Bemerkenswert ist ja auch, dass inzwischen erstmals auch ein Kunstwerk durch Künstliche Intelligenz kreiert wurde. Es handelt sich um ein Porträtgemälde, das von einem Algorithmus entwickelt wurde und von der eigenen Software mit Mitteln der Gesichtserkennung als Porträt erkannt wurde. Das ist für mich eine Weiterentwicklung von Konzeptkunst.
Dann wären aus Ihrer Sicht Programmierer auch eine Art Künstler?
Ob man wie Duchamps den Flaschentrockner zum Kunstwerk erklärt oder ob man quasi einen aktiveren Flaschentrockner in die Welt setzt, einen Algorithmus, ist durchaus vergleichbar: er ist eine vom Menschen geschaffene Formel, die ja letztlich auch nur Menschen Spass macht, weil es um Fragen nach der Grenze des Schöpferischen und um die spielerische Rezeption von Kunstgeschichte geht.
Veröffentlicht unter Allgemein, Blick hinter die Kulissen
Schlagwörter: Digitalisierung